Pascale Kramer
Notice biographique
- Bibliographie - "Manu"
et "Onze ans plus tard" -
Pascale Kramer, Anne-Lise Grobéty : due scritture femminili
-
L'implacable brutalité du réveil
| Notice
biographique |
 Née à Genève en 1961, Pascale Kramer publie ses deux premiers romans aux Editions de l'Aire alors qu'elle a tout juste passé la vingtaine: Variations sur une même scène (1982) et Terres fécondes (1984). S'ensuit un silence de dix ans, pendant lequel elle monte un bureau de conception en publicité à Paris, où elle vit et travaille depuis 1987. Née à Genève en 1961, Pascale Kramer publie ses deux premiers romans aux Editions de l'Aire alors qu'elle a tout juste passé la vingtaine: Variations sur une même scène (1982) et Terres fécondes (1984). S'ensuit un silence de dix ans, pendant lequel elle monte un bureau de conception en publicité à Paris, où elle vit et travaille depuis 1987.
De Manu à L'Implacable brutalité du réveil , qui met en scène une jeune femme oppressée par la maternité, elle excelle à créer des atmosphères denses, une impression subtile de malaise. «Ce climat angoissant se fait moteur narratif et les protagonistes, et le lecteur avec eux, se trouvent englués, s'embourbent peu à peu dans une nébuleuse muette dont ils sentent confusément qu'il n'est pas possible de se dépêtrer», écrit Aline Delacrétaz dans la revue Viceversa 1. Chacun des livres de Pascale Kramer, «sorte de creuset humain et stylistique, est plus intense et plus surprenant que le précédent. L'écriture y est à chaque fois plus sobre et plus incisive, la dentelle plus fine et plus précise.»
APD
|
|
| Bibliographie |
Publications
| Variations sur une même scène , L'Aire, 1982. |
| |
Terres fécondes , L'Aire, 1984. |
| |
Manu , Calmann-Lévy, 1995 - Prix Dentan 1996 |
| |
Le bateau sec , Calmann-Lévy, 1997. |
| |
Onze ans plus tard , Calmann-Lévy, 1999 (repris en Folio n°3444) |
| |
|
Les Vivants , Calmann-Lévy, 2000 (repris en Folio n°3738) - Prix Lipp 2001 |
| |
| Préambule à la barque (nouvelle), in Document Stéphane Zaech , Editions art & fiction, 2002. |
| |
Retour d'Uruguay , Mercure de France, 2003. |
| |
L'adieu au Nord , Mercure de France, 2005. |
| |
Fracas , Mercure de France, 2007. |
| |
L'implacable brutalité du réveil, Editions Mercure de France, 2009
Grand Prix du roman de la S.G.D.L, Prix Schiller, Prix Rambert 2010. |
Deutsche Uebersetzungen
Die Lebenden , Uebersetzung von Andrea Spingler, Zürich-Hamburg, Arche Verlag, 2003. |
| |
Züruck , Uebersetzung von Andrea Spingler, Zürich-Hamburg, Arche Verlag, 2004. |
| |
Abschied vom Norden, Uebersetzung von Andrea Spingler, Zürich-Hamburg, Arche Verlag, 2007. |
Traduzioni italiane
Manù , traduzione di Anna Pensa, Napoli, Cronopio, 1997. |
|
|
| "Manu"
et "Onze ans plus tard" |
| |
|
EIN GANZ ALLTÄGLICHES
VERSAGEN
"Manu " und "Onze
ans plus tard " -
zwei irritierende Romane der Westschweizerin Pascale
Kramer
Pascale Kramer schreibt
in ihren Romanen über das Universum erstarrter
Paarbeziehungen, des Mittelmässigen und subtiler
Gewalt. Die Texte der in Paris lebenden Autorin
atmen Welthaltigkeit und entbehren ganz der oft
limitierenden Verankerung in den Westschweizer
Zuständen, ohne die die französischsprachige
Literatur der Schweiz nicht auszukommen scheint.
|
|
Pascale Kramers Romane erinnern ein wenig an die Kriminalgeschichten, die mit einem Toten und einem Mörder anfangen. Der Leser weiss also mehr als die Polizei und kann zu jedem Zeitpunkt beurteilen, wie weit die Polizei von der Aufklärung des Falls entfernt ist. Nur: Der Tod, von dem aus die 38jährige Autorin ihre Geschichten in die Vergangenheit zurückspult, tritt zufällig ins Leben - und erscheint doch als Folge jahrzehntelangen menschlichen Versagens, als unmittelbare Konsequenz alltäglicher Egoismen und Hassgefühle, mit denen sich Menschen die Hölle auf Erden bereiten. Auch ist es nicht die Polizei, die Ermittlungen führt, sondern Pascale Kramer tut dies selbst, indem sie jeweils eine "Chronique d'une mort annoncée" erzählt, an dessen Anfang der Tod gleichsam als eine unausweichliche Folge des Erzählten erscheint. In "Manu", Pascale Kramers 1996 mit dem renommierten Westschweizer Prix Dentan ausgezeichneten Erstling, stirbt ein vierjähriges Kind an einem Hitzeschock in der Badewanne eines Athener Appartements. Dorthin war es verfrachtet worden, um Platz zu schaffen für eine von Yvans ausschweifenden Parties.
In einer Lüge nimmt die tragische
Entwicklung ihren Anfang. Um Manu, die er in einem Bus kennenlernt,
schneller verführen zu können, gibt sich Yvan als
Witwer aus. Maria, seine Frau, ist für zwei Wochen nach
Italien zur Beerdigung ihres Vaters gefahren. Im Schwindel
der Sorglosigkeit driften Yvan und Manu in eine irreale Welt
aus Ennui und Leidenschaft. Ob er Manu liebt, weiss Yvan eigentlich
gar nicht. Allein Manu empfindet aufrichtige Gefühle,
doch Yvan verfällt immer wieder in jene Momente emotionaler
Lähmung, die er auch bei Maria erlebt. Kaum auszuhalten
ist die Spannung zwischen Manus Erwartungen und Yvans Feigheit,
ihr die Wahrheit zu erzählen. Dumpf liegt die Hitze des
Athener Sommers über dem Geschehen. Sie scheint allen
den Sinn für die Realität zu rauben. Yvans kleiner
Sohn erweist sich bald als ein Störfaktor im unbegrenzten
erotischen Spiel. Schemenhaft zeichnet Pascale Kramer die
Vorahnungen der Katastrophe: Kleine Verletzungen, die sich
das Kind beim Spielen zuzieht, weil niemand auf es aufpasst.
Einer göttlichen Strafe gleich bricht dann das Irreparable
über Yvan herein: Verbannt in die feuchte Schwüle
des Badezimmers stirbt das Kind am Tage von Marias Rückkehr.
Pascale Kramer beschreibt ein Universum,
das seine Personen mit den Banden der Gewohnheit und Mittelmässigkeit,
vor allem aber einer unter die Haut gehenden Charakterlosigkeit
gefangenhält, mit hoher atmosphärischer Dichte:
mal feuchtschwül, mal erstickend, dann wieder mörderisch
und eisig zugleich - eine Virtuosität, die ihr auch in
ihrem neusten Roman "Onze ans plus tard" in bemerkenswerter
Weise gelingt. Auch die Erzählstrucktur wurde bereits
in "Manu" erprobt. Am Anfang steht einmal mehr ein
tragischer Tod. David stürzt zu Tode, als er versucht,
einen Ball aus der Regenrinne zu holen. In der Zufälligkeit,
Tragik und Ungeschicklichkeit, die Davids Tod anhaften, spiegelt
sich die Unerfülltheit aller Ideale, die am Anfang seiner
Ehe mit Betty vor 11 Jahren standen. Elf Jahre des sozialen
Aufstiegs, elf Jahre der reziproken Indifferenz, der entäuschten
Hoffnung, aber auch der Anhäufung von Lebenskomfort,
in dem man bald eine schmerzlindernde Wirkung erkannt hat.
Jeder hat Gründe, den anderen zu hassen. Betty hasst
David, weil er sie ganz offenkundig betrügt, David nimmt
ihr eine Fehlgeburt übel. Wie vergiftete Pfeile schiesst
die Sprache der täglichen Schuldzuweisungen zwischen
den beiden hin und her. Im letzten Moment nimmt man sich immer
wieder zurück, gauckelt sich selbst oder den Freunden
die heile Welt vor. Pascale Kramer verzichtet ganz auf direkte
Rede. So wirkt der Wortwechsel mitunter manieriert, was die
vernichtende Suggestivkraft des Gesagten noch potenziert -
einzigartig in der französichen Literatur der neunziger
Jahre, aber auch irritierend, nur schwer aushaltbar.
Wie in "Manu" gelingen Pascale
Kramer beklemmende Bilder individueller Hilflosigkeit, ja
der Lächerlichkeit, im Augenblick der höchsten Spannung:
etwa Davids Hin- und Herschwingen wie ein Telegraphenmast
im Sturm unmittelbar vor dem Sturz, Bettys Haarknoten, der
sich in den Rosen verfängt und für dessen Befreiung
sie eine kleine Ewigkeit braucht, das dumpfe Geräusch
des unzählige Male ausfringenden Balles auf dem Dach.
Pascale Kramer gestaltet hier rhythmische Indizien einer ungenutzt
verstreichenden Lebenszeit.
Davids Tod setzt einen Schlusspunkt
und scheint Betty in ebenso tragischer wie wundersamer Weise
ein Stück Freiheit wiederzugeben, jene eigene Entfaltungs
möglichkeiten mithin, die sie vor elf Jahren aufgab.
Doch selbst jetzt ist Betty unfähig, sich aus den Denkschemata
und Zielen ihres Paarlebens zu lösen. Sie wolle sich
nun ein neues Auto kaufen, lässt sie ihre Freunde wissen.
Es ist das letzte, was wir von ihr hören.
In beiden Romanen überzeugen die
Ökonomie der darstellerischen Mittel ebenso wie die hochkonzentrierte
Plotgestaltung. Pascale Kramer verfügt über eine
beachtliche sprachliche Kunstfertigkeit und über unbegrenzte
Möglichkeiten, Stimmungen herzustellen. Neben Elisabeth
Horem, der Weitgereisten, die in ihren Romanen Szenarien der
Erinnerung an fremde Welten konstruiert, die nur in ihrer
Imagination zu existieren scheinen, hat mit Pascale Kramer
in der Mitte dieses Jahrzehnts eine weitere Stimme die literarische
Bühne der Westschweiz betreten, die Distanz nimmt zum
Milieu, zu jenen oftmals limitierenden, diversen, persönlichen
oder sozioprofessionellen Umgebungen mithin, mit denen so
viele Autorinnen und Autoren zwischen Porrentruy und
Sierre, Genf und Fribourg ihre Geschichten
alimentieren. Ob es sich bei dieser geographischen und atmosphärischen
Distanznahme um Einzelfälle oder eine Tendenz handelt,
werden die nächsten Jahre zeigen.
Pascale Kramer, Manu, Calman-Lévy,
Paris 1995
Pascale Kramer, Onze ans plus tard, Calman Lévy, Paris
1998.
Michael Wirth
Avec l'autorisation de la
Schweizer Monatshefte
|
|
| Pascale Kramer,
Anne-Lise Grobéty : due scritture femminili |
Una vicenda immaginata da Tennessee
Williams, con personaggi di Francis Scott Fizgerald, in una
scenografia disegnata da Dennis Hopper. Con questi tre riferimenti
americani potremmo riassumere l'angoscia che ci lascia addosso
Pascale Kramer, con questo Les vivants: pubblicato da più
di un anno ma ora coronato dal premio Lipp di Ginevra. In
una casa esposta al sole e al vento, in un'estate tragica,
quattro personaggi profondamente immaturi si trovano confrontati
a un destino orrendo. Louise e Vincent perdono i loro due
bambini in un incidente rapido e insensato. Dopo di che Vincent,
Louise, suo fratello Benoît e la loro madre, incapaci
di reagire e soffrire si consumeranno in una claustrofobica
desolazione. Le loro vite si scuciranno, come se un filo da
imbastitura bianco-sporco e molliccio le avesse fino ad allora
tenute insieme. In silenzio, alla deriva. Potrebbero essere
personaggi di Moravia, se la loro noia avesse un fondamento
metafisico. Ma da questo libro si esce cambiati, trasfigurati
dalla rabbia che si prova per l'inutilita di tanto soffrire,
per l'aria viziata dall'egoismo e dal torpore. La conclusione
e d'un'agghiacciante verita. Sfuggire al dolore immobile e
insolubile e ancor piu tragicamente doloroso.
Meno sottile il disegno di Anne-Lise
Grobéty, che con Le temps des mots a voix basse ci
consegna - dopo nove anni di silenzio - un racconto per ragazzi
di disarmante buonismo: due amici del cuore, i loro padri
uniti dalla passione per la poesia, il nazismo e l'inevitabile
separazione dall'amico ebreo. Da L'amico ritrovato ad Arrivederci
ragazzi, il tema e stato troppo stupendamente trattato, perche
la scrittrice neocastellana - nata nel 1949 - possa aggiungervi
un sentimento nuovo. Al di la delle buone intenzioni, il suo
ritorno narrativo delude dunque: e non ci resta che aspettarla
ad una prossima prova piu consona alla finezza cui questa
autrice ci ha abituato.
Pierre Lepori

Radio Svizzera Italiana –
Rete2
|
|
| L'implacable brutalité du réveil |
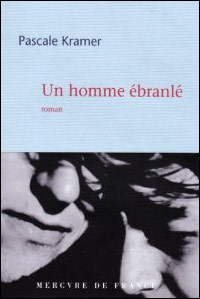 Elle avait imaginé un presque adolescent, c'était encore un garçon dont la lourde tignasse châtain-roux s'arrêtait haut sur la nuque dans une brusquerie bâclée de coups de ciseaux. Il était petit pour onze ans, son ventre précipitamment rentré faisait ressortir des pectoraux joliment grassouillets. La ressemblance avec Claude était cocasse dans cette chair jeune et sensuelle. Simone se demanda si eux pouvaient la voir. Elle se présenta, tenta un sourire, ne sachant pas si on embrasse encore à cet âge. Il y avait quelque chose d'étonnamment doux et adulte dans cette crânerie timide de onze ans. Simone n'en revenait pas de comprendre qu'il était parfaitement résolu à être là. Elle avait imaginé un presque adolescent, c'était encore un garçon dont la lourde tignasse châtain-roux s'arrêtait haut sur la nuque dans une brusquerie bâclée de coups de ciseaux. Il était petit pour onze ans, son ventre précipitamment rentré faisait ressortir des pectoraux joliment grassouillets. La ressemblance avec Claude était cocasse dans cette chair jeune et sensuelle. Simone se demanda si eux pouvaient la voir. Elle se présenta, tenta un sourire, ne sachant pas si on embrasse encore à cet âge. Il y avait quelque chose d'étonnamment doux et adulte dans cette crânerie timide de onze ans. Simone n'en revenait pas de comprendre qu'il était parfaitement résolu à être là.
À cinquante ans, Claude voit dans la maladie qui le frappe une alliée pour s'évader d'un monde en feu pour lequel il a un jour renoncé à se battre. Mais il y a Gaël, ce fils de onze ans qu'il s'est décidé trop tard à rencontrer, Jovana dont la belle énergie revient le hanter, et sa femme Simone, spectatrice lucide et glacée face aux tourments d'un homme qu'elle aime encore.
Pascale Kramer, Un homme ébranlé, Editions Mercure de France, 2011, 132 pages.
Page créée
le 01.08.98
Dernière mise à jour le 10.02.11

|
|
|
© "Le Culturactif
Suisse" - "Le Service de Presse Suisse"
|
|

